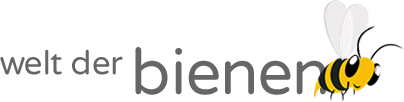Wabenerneuerung gegen das Winterbienensterben und Hypothesen zur Bekämpfung der Varrose mit neuen Ansatzpunkten.
Es ist allen bekannt, dass vor mehr als 30 Jahren (in der Schweiz erstmals 1984) die Varroamilbe nach Europa eingeschleppt worden ist und sie schadet seither unseren Bienenvölkern in steigendem Masse. Die Forschung zu ihrer Bekämpfung hat vieles zu Tage gefördert. So sind wir dank des Forschungsberichtes von Gérard Donzé im Jahr 1998 über die Entwicklung und Vermehrung der Milbe genau im Bilde. Durch ihr Schmarotzertum schwächt sie nicht nur die Bienen, sondern überträgt auch Bakterien und Vieren, die grosses Unheil an unseren Bienen bewirken. Heute müssen wir uns leider eingestehen, dass trotz allem Aufwand gegen die Milbe ihr nicht grundlegend beizukommen ist.
(Es leuchten aber Hoffnungslichter am Horizont. Die Forschung ist dabei heraus zu finden wie die Milbe durch einen Pilzbefall wirksam zu bekämpfen ist, oder aber auch durch Massnahmen, die zur Sterilität der Milbe führen sollen, und ihr somit den Garaus machen könnten.)
Der Forscher GèrardDonzé zeigt deutlich auf:“ Die Fortpflanzung der Milbe erfolgt ausschliesslich in den verschlossenen Brutzellen. Kurz nach der Königin-Eiablage dringen die Milbenweibchen in eine Zelle ein und verharren im Futtersaft, der dann von der aus dem Ei schlüpfenden Made verzehrt wird. Ist diese Anfangsphase vorbei, wird die Made von Bienen gefüttert und die frei gewordene Milbe beisst sich nun an ihrem Fettkörper zwecks Ernährung fest. Dieses Verhalten scheint anfangs zum Eigenschutz der Milbe vor den brutpflegenden Bienen zu erfolgen. Nach 10 Tagen signalisiert die nun zur Streckmade herangewachse ihren Reifestand mit einem Duft, sodass die Arbeiterbienen den Termin zum Zudeckeln wahrnehmen, aber auch noch weitere Milben zuwandern können.Kurz nach der Verdeckelung wird sie zur Spinnmade. Die Milbe hat nun ungestörte 11 Tage Zeit sich zu vermehren und sich an einem Frassloch am Körper der Made zu ernähren.
Neueste Forschungen an der Universität in Maryland von Samuel Ramsey und seinem Team haben herausgefunden und belegt, dass die Varroa-Milbe sich vom Fettgewebe der Biene ernährt, nicht von der Hämolyphe der Blutflüssigkeit der Biene! Nachzulesen in der Schweizerischen Bienenzeitung 12/2018
Wer Nahrung zu sich nimmt muss sie auch wieder ausscheiden! Aufregend ist hierbei, wie Donzé erforscht hat, dass die Milbe immer am gleichen Ort ihren Kot ablegt, sodass bis zuletzt ein richtiger Kothaufen entsteht! Auch die heranwachsende Brut geht auf diesen Kothaufen. Jeder Kot hat eine ätzende Wirkung und die Milbe ist nicht daran interessiert ihren Wirt damit zu schädigen. Auch saugt sie immer am gleichen Frassloch und kann hier ihre krankmachenden Vieren oder Bakterien direkt an die Biene abgeben. Erst wenn der Chitinpanzer der Bienenpuppe erhärtet ist, beisst sie für sich und die Brut, welche noch nicht über die nötigen Werkzeuge verfügt, ein neues Loch.
Neue Forschung belegt, dass die Varroamilbe sich ausschliesslich vom Fettkörper ernährt.
In der Oktoberausgabe 2023 der schweizerischen Bienenzeitung wurde ein Artikel veröffentlicht, der aufs Genaueste belegt, dass sich die Milbe nur vom Fettkörper ernährt. Dr.Dennis van Engelsdorp und Samuel Ramsey an der Universität of Maryland /USA haben akribisch geforscht und bewiesen, dass es die Milben nur auf das Fettgewebe abgesehen haben. Diese Tatsache entspricht auch der Speiseaufnahme aller Spinnentiere. Das wirft neue Fragen auf, wie man die Varroa künftig gezielter bekämpfen kann.
Der Fettkörper umschliesst den ganzen Hinterleib der Biene und ward bisher noch nie anatomisch bestimmt und festgehalten worden. Um an ihn ungestört heranzukommen, bevorzugt die Milbe die untere Bauchseite der Biene und dringt unter die überlappenden Bauchsegmente des Chitinpanzers. Dort ist sie so geborgen, dass sie auch beim Putzen von den Helferbienen nicht entdeckt noch entfernt werden können. Das gibt ihnen wahrscheinlich die Möglichkeit auch bei Säurebehandlungen überleben zu können, weil sie den Kopf tief in den Fettkörper hineinverbeissen. Da Milben der Gattung Spinne zugeordnet sind, haben sie auch den gleichen Frassmechanismus. Sie können nicht gleich lossaugen, so wie man das fälschlicher Weise annahm, als man noch vermutete die Hämolyphe wird von der Varroa abgesaugt und aufgenommen. Nein, sie muss erst ein Sekret injizieren, dass das Fettgewebe verflüssigt, damit sie es dann aufsaugen kann. Es liegt ja nahe, dass die Wachsschüppchen auch gerade an diesem Ort herausgeschwitz werden. Der Fettkörper ist für die Biene ein sehr wichtiges Organ, das unserer Leber in der Funktion ähnlich ist. Es ist absolut lebenswichtig für die Honigbiene und wenn es durch Frass geschädigt wird, schwächt das die Biene in höchstem Masse besonders, wenn die Muttermilbe viel Nachwuchs hat. So kann es auch zu deformierten Flügeln kommen. Geschwächte Bienen wachsen zwar normal heran, wenn sie aber ausfliegen, zeigt sich erst der Schaden. Manche können nur krabbeln vor lauter Schwäche, obwohl die Flügel intakt sind. Anderen gelingt es bis zur Trachtblüte zu fliegen, schaffen aber den Rückflug nicht mehr. Dieser Bienenverlust kommt erst bei den Winterbienen zum Tragen, weil die Bruttätigkeit rapide abnimmt. Den Forschern ist es auch gelungen aus Milbenkot – Analysen den Nachweis zu erbringen, dass die Nahrung der Varroa nicht Hämolyphe ist, denn dann hätten sie viel Wasser mit ausscheiden müssen, sondern von organischer Substanz (Eiweissverdauung) ist. Das rückt eine Ölsäure – Behandlung, die in die Brutzellen, speziell bei Drohnenbrut gesprüht wird, in den Vordergrund.
Spezielle Eiablage der Muttermilbe
Bei der Ablage des Eies benutzt die Milbe eine spezielle Strategie. „Das Ei wird so an die Wabenzellwand geklebt, dass die Bauchseite der darin befindlichen Nymphe zur Zellwand gerichtet ist. Auf diese Weise kann sie sich beim Schlüpfen mit den Beinen an der Wand halten und aus der Eihülle ziehen.” Trotz der steigenden Milbenpopulation in der Zelle, wird die angehende Biene selten getötet, denn die Milbe braucht sie lebend, um auf ihr wieder aus der Zelle heraus zu gelangen.
Wir Imker wissen, dass einer der wichtigsten Funktionen im Bienenstock das Zellenputzen ist. Jetzt muss also ein beachtlicher Ballen Kot, sofern er nicht an der geborenen Biene haftet, aus den Zellen herausgeholt und abtransportiert werden. Die Jungbiene fängt damit an und reicht ihn weiter. Durch wie viele Bienenmandibeln er wandert, bis er nach Draussen gelangt, wissen wir nicht, aber bestimmt nicht nur durch die Mandibeln der frisch geschlüpften Bienen. Als gleichzeitige Ammenbiene geschieht unter Umständen das, dass sie Rückstände vom Kot im Mundorgan gleich an die Maden weiter überträgt. Diese kämen schon sehr früh damit in Kontakt und werden möglicherweise auf diese Weise von Vieren infiziert.
Tatsache ist, der Kot besteht aus dem von Milben verdautem Fettgewebe. Da die Biene den Kot mit den Mundwerkzeugen aufnimmt, könnte eine breite Infizierung im Volk stattfinden und somit erklären, wieso es zu einem Leerflug kommt.
Vermutlich nimmt sie auch von dem Kot Spuren in ihren Verdauungstrakt auf. Bei der Sommerbiene wirkt sich ein erfolgter Schaden noch nicht so aus, weil die Infektionen, die so übertragen wurden, mit der ihr vorgegebenen Lebensdauer Schritt halten. Aber wissen wir, ob die Honigbiene überhaupt noch die Kraft hat, über den Zeitraum von zehn Tagen, Nektar einzutragen? Schrumpfen nicht auch schon im Sommer die Völker? Ferner ist zu beachten, dass es ab Ende Juli schon mit der Brut der Winterbienen einsetzt. Winterbienen verhalten sich anders, sie sind passiver. Sie beteiligen sich nicht an der Brutpflege, weil sich ihre Futtersaftdrüsen zurückbilden. Sie übernehmen auch keine anderen Arbeiten im Bienenstock, auch kein Putzen, sondern konzentrieren sich ganz auf den Pollenkonsum. Die Eiweisse dieser Nahrung speichern sie im Fettkörper und in der Hämolymphe. Das ist für sie wichtig, um den Winter zu überdauern. Das Absaugen vom Fettkörper durch die Milbe, ist hier besonders schädigend. Es verkürzt die Lebensdauer der Winterbienen und so haben sie keine Möglichkeit den Winter zu überstehen. Oft sterben sie schon gleichzeitig mit den letzten Sommerbienen und der Imker hat den Verlust zu beklagen. Wer hat nicht schon den starken Totenfall vorm Stock im Spätherbst erlebt und gesehen?
Man sollte sich vergegenwärtigen, dass die Varroamilbe keine Augen, dafür aber einen sehr sensiblen, ausgeprägten Geruchssinn hat. Als Spinnentier hat sie acht Beine, wovon die zwei vorderen weniger zum Laufen geschaffen sind, weil an den Vorderbeinen sich alle Sinne, die eine Milbe benötigt befinden. Tastsinn, Geruchssinn und Orientierungswahrnehmungen des Raumes und der Temperatur.
Tote Milben ohne Beine; wahre Ursache.
Im Gemüll kann der aufmerksame Imker, mit Lupe ausgestattet, tote Milben ohne Beine finden. Man nahm bisher an, diese seien von Putzerbienen abgebissen worden. Das wurde aber durch den Bienenforscher Gerhard Liebig Hohenheim durch langes Beobachten widerlegt. Es handelt sich nicht um Milben, von denen sich Bienen gegenseitig entledigten und sie mit Abnagen der Beine töteten, sondern um vorher abgestorbene Muttermilben in den Zellen. Muttermilben können ihren Vermehrungszyklus maximal drei mal wiederholen, dann sterben sie und bleiben in der Zelle liegen. Ebenso stirbt dann das Männchen und die Tochtermilbe mit ab. Beim Reinigen der Zellen, werden die Milben bereits mit Beinverlust heraus getragen, denn bei toten Milben fallen die Beine leicht ab.
Man kann die Milbe nicht ausrotten, aber versuchen sie von den Bienen fernzuhalten!
Was wäre nun dagegen zu tun? In jedem Fall sollte der Imker auch dahin tendieren, die Wabenerneuerung als eine einfache Hilfe durchgreifend zu praktizieren. Wer mit Magazinen arbeitet, die mit gleich grossen Waben im Honig – wie im Brutraum ausgerüstet sind, hat es leicht den Bienen die leeren, neuen und sauberen Honigwaben anzubieten. Ansonsten hängt man neue Mittelwände ans Brutnest und schiebt die alten Waben immer mehr an den Rand. Es wird empfohlen, die Brutwaben keinesfalls länger als drei Jahre zu behalten.
Meine Erfahrung mit dem Bücherskorpion ging schief. Zum einen muss man die Beute aufwendig umgestalten und zum anderen sind sie mit den Bienen wieder abgezogen, denn die Spalten, die die Bücherskorpione zur Vermehrung brauchen, haben die Bienen alle mit Propolis zugemauert. Meine gewonnene Überzeugung ist diese, wenn Bücherskorpione von alleine im Stock anwesend sind, stimmt das Ökosystem und die Bienen fühlen sich wohl. Das gelingt am besten bei der Zeidlerei. Im lebenden Baumstamm stimmt das Klima von Natur aus und dadurch haben Bienen viel weniger Stress, können sich besser putzen, Temperatur und Raumfeuchtigkeit lassen sich leicht regeln, Bakterien, Mikroorganismen, Ameisen und Bücherskorpione sorgen für eine saubere Stube.- Wer sich die Mühe machen will seine Bienen so zu halten, resigniert früher oder später.
Überlebenschancen in Baumhöhlen heute?!
Gerhard Liebig hat in seiner Forschung von Bienen in Baumhöhlen, im Gegensatz zu heutigen Behauptungen festgestellt, dass Bienen in Baumhöhlen genauso der Sterblichkeit den Milben unterworfen sind, wie in Magazinen beim Imker. Ihre Überlebenschance sei prozentual niedrig. Die Erklärung liegt darin, dass es heute zu viele Imker hat, denen die Schwärme abhauen und oftmals eine leere, vom verstorbenen Bienenvolk verlassene Baumhöhle in Besitz nehmen. Bis sie ihr Nest gesäubert, neu aufgebaut und der Königin Zellen zur Eiablage bieten können, verliert der Schwarm an Kraft. Da es sich überwiegend um alte Königinnen handelt, ist sie mit der Eiablage nicht mehr so produktiv. Ein Umweiseln des Volkes trägt auch nicht zu der notwendigen Stärke bei, sodass nicht genug Vorrat für den Winter eingeholt werden kann. Das Volk ist klein und nicht überwinterungsfähig. So ergeht es den meisten Völkern in freier Wildnis. Im Frühjahr hat alsbald ein neuer Schwarm Einzug gehalten, sodass die irrige Meinung entsteht, ein Überleben habe stattgefunden. Früher waren die Bienenvölker kleiner, sie passten sich der Grösse der Höhle an. Eine Erweiterung war oft nicht möglich und so schwärmten sie in die nächste Baumhöhle aus. Erst durch die Imkerei mit ihrer Zucht und Pflege, die Methoden der Erweiterung, Fütterung, Erneuerung der Königin und Teilung sind grosse Bienenvölker überhaupt möglich geworden. Quintessenz: in einer Baumhöhle ist die Überlebensrate der Bienenvölker nicht höher. Die Milbe wütet allgegenwärtig und zerstörerisch.
Siehe unter Varroa: Varroamilbe-bekämpfen
Oelsäureanwendung
Peter Rosenkranz und Bettina Ziegelmann von der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität zu Hohenheim Deutschland, haben neue Erkenntnisse zur Varroabekämpfung mit Oelsäure gewonnen. Oelsäure enthält eine Komponente des Varroa-Sexualpheromons. Sie wenden damit eine direkte Sprühapplikation in die Wabenzellen an. Die Duftstoffe der Oelsäure verwirrt das zuerst geborene Milbenmännchen, das für die Befruchtung nachfolgender Milben verantwortlich ist, in der Zelle dermassen, dass es wild umher tigert und die Tochtermilben kaum zur Begattung auffindet. Somit dezimiert sich die Milbenpopulation auf die Hälfte. Neueste Anwendungspraktik geht dahin, dass die Oelsäure direkt in das Wachs der Mittelwände mit eingeschmolzen wird. Der Nachteil ist leider der, dass das Wachs somit verunreinigt wird. Jedoch wird der Honigraum nicht damit behandelt, sodass man den Wachs nur im Brutraum verunreinigt und entsprechend seine Konsequenzen daraus zieht. Eine offizielle Behandlungsmethode damit ist noch nicht auf dem Markt.
Umstellung auf das Kleinzellenmass 4.9mm
Die Umstellung auf das Kleinzellenmass soll sehr wirksam sein, wenn es einem gelingt die Bienen dazu zu bewegen. Es eignet sich am besten die braune Biene dafür. Wenn man aber zum Vorspuren Kunststoffwaben mit dem Mass 4,9mm anwendet, erlernen es die Bienen sofort und man kann in zweiter oder dritter Bienengeneration die Kunststoffwaben wieder entfernen. Mit dieser Methode gelingt es offenbar bei jeder Bienenrasse, auch bei Mischvölkern die Umstellung auf das Kleinzellenmass zu erreichen. Man kann sich im Internet über den Erwerb von Kunstoffwaben, sowie über Matritzen zu Kleinzellenmittelwänden informieren. Meine Haltung im Kleinzellenmass (4,9) ist aber nicht überzeugend!
Pia Aumeier und Gerhard Liebig haben allerdings in ihrer intensiven Forschung und Beobachtung den Nutzen mit dem Kleinzellenmass widerlegt. Es habe sich nicht bewahrheitet, dass eine bessere Überlebenschance gegen die Varroa bestehe. Die Milbe passt sich an und vermehrt sich uneingeschränkt. Die Bienen bauen die Waben unregelmässig aus und können mit ihrer Körpergrösse in kleiner gebaute Zellen nicht eindringen, um sie sauber zu halten und die kleinen Larven zu umsorgen. Quintessenz: der Aufwand lohnt sich nicht, er führt nicht zum gewünschten Durchbruch.
Nützlinge unter den Milben
Phänomen Milbe. Nicht alle Milben sind Parasiten, es gibt auch Nützlinge unter ihnen. Da kennen wir zum einen die Raubmilbe, die Hühner von der Hühnermilbe befreit, indem sie diese verzehrt.
Den meisten Imkern ist auch bekannt, dass die Erdhummelkönigin im zeitigen Frühjahr am Brustkörper dicht mit Milben besetzt ist. Die Milben sind vor der Winterruhe im Nest auf die Hummelkönigin aufgestiegen und haben mit ihr den Winter überlebt. Das ist auch gut so, denn die Milben krabbeln wieder von der Hummel herunter, sowie sie mit dem Brutnest beginnt. Als „Kommensale“ ernährt sie sich von den Pollenresten in dem Kot der Hummellarven und sorgt somit für eine hygienische Kinderstube. Eine Kommensale ist im Gegensatzt zum Parasiten ein Lebewesen, das sich von den Nahrungsrückständen eines Wirtsorganismus (die Hummelbrut) ernährt, ohne es zu schädigen.
Wie bei den Hummeln wurden auch bei den Wildbienen schon Milben entdeckt, darunter die Nisthilfen beziehenden Arten: die Hahnenfuss- Scherenbiene (Chelostoma florisomne), die Rote Mauerbiene (Osmia rufa) und die gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta). Auch hier haben es die Nutzmilben auf Pollenrückstände abgesehen. Ist hingegen der schützende Kokon einer Larve oder Puppe beschädigt, so können diese auch befallen und geschädigt werden. Im Frühjahr lassen sich die an die Männchen geklammerten Milben bei der Paarung auf das Weibchen übertragen. Diese schleppen die Milben wieder in neue oder in die alten Brutnester ein.
Milben an Wildbienen und Hummeln
Bei meinen Beobachtungen „der Frühlingsblumen am Fenster“ ist mir die Holzbiene auf der blauen Hyazinthe begegnet. Das seltene Ereignis, sie bereits so früh im Jahr in der Nordschweiz fotografisch einfangen zu können, beglückte mich. Erstaunen kam bei der Entdeckung auf, dass ihre hellere Farbtönung zwischen Brust- und Hinterteil hervorgerufen wurde durch einen dichten haftenden Milbenbelag.
Nun wollte ich es genau wissen, was das zu bedeuten hat, und fand im Internet eine ausgiebige wissenschaftliche Erklärung von Werner David (mit Studium der Biologie und Chemie, Lehramt am Gymnasium München), die ich hier in Kurzfassung weitergeben möchte.
Die Milbe (Chaetodactylus osmiae): ein Spinnentier mit acht Beinen
Es handelt sich bei dieser Milbe nicht um eine saugende, sondern um eine schmarotzende Milbe, die im Gelege der Wildbienen den Vorrat an Pollen und Nektar verzehrt, der dann der Aufzucht der Wildbienen fehlt. Meistens werden aber die Brutzellen im Überfluss mit Nahrung versorgt. Nun kann es vorkommen, dass so viele der Milben in der Bruthöhle sich an den jungen geschlüpften Bienen anhaften und mit ihnen aus dem Brutgang herauskommen, dass die Biene durch die Last flugunfähig wird und somit verhungert. Es gibt Bienenkörper, die über und über in mehreren Schichten von Milben bedeckt sind. Man schätzt, dass in so einem Fall es sich um mehr als tausend Spinnentiere handelt. Mit dem Tod der Biene gehen auch alle aufsitzenden Milben ein. Damit sind aber die Milben nicht aus der Welt, mitnichten! Der Milbenbesatz, der an meiner beobachteten Holzbiene sass, krabbelt, falls er sich auf einem Männchen befindet, bei der Paarung auf das Weibchen über und lässt sich direkt in die nächste Brutröhre transportieren, wo er sich fallen lässt und seinen Vermehrungszyklus beginnt.
Direkter Reproduktionszyklus
Lassen wir Werner David hier zu Wort kommen: „Die Entwicklung der Milben ist äusserst komplex und besteht aus zwei verschiedenen Reproduktionszyklen, einen direkten und einen indirekten. Der direkte Entwicklungszyklus läuft unter normalen Bedingungen ab, solange noch ausreichend Pollen, Nektar und Feuchtigkeit in den Zellen vorhanden sind. Der komplette Zyklus kann bis zu zehn Mal in einer einzigen Saison ablaufen und führt zu einer starken Vermehrung der Milben.“
Indirekter Entwicklungszyklus
„Dieser Zyklus setzt ein, wenn sich die Nahrung in der Zelle dem Ende nähert. Typisch für das sogenannte Hypopopus- Stadium ist das komplette Fehlen einer Mundöffnung und Mundwerkzeugen. Hingegen haben sie gute Klammerorgane an den Beinen mit denen sie sich an den schlüpfenden Bienen festhalten können. Die Milbenlarven sind daher nicht in der Lage Nahrung aufzunehmen und müssen von ihren körpereigenen Vorräten zehren. In diesem sehr widerstandsfähigen Stadium findet auch die Überwinterung statt. Die Milben im Hypopopus-Stadium bleiben in der Nisthilfe zurück und sind dort mehrere Jahre lang überlebensfähig. Erst wenn wieder Nahrung zur Verfügung steht, läuft die Entwicklung weiter. Diese Variante ist sozusagen die eiserne Reserve, die auch dann überlebt, falls alle Milben ausserhalb des Nistganges zugrunde gehen sollten. Sobald wieder Nahrung zur Verfügung steht, entwickeln sich die Milbenlarven zu adulten Weibchen und der Zyklus kann von Neuem beginnen.“
Fazit
Es liegt nahe, dass die Nisthilfen, die heute überall zur Rettung der Wildbienen propagiert werden, die Milbenpopulation fördern und somit den Wildbienen einen Bärendienst erweisen. In der Natur suchen sich Wildbienen mehrheitlich immer neue Nistplätze, sodass Milben nur eine geringe Chance haben, aus ihrem Hypopopus-Stadium eine neue Population aufzubauen, es sei denn, man errichtet jedes Jahr ein neues Bienenhotel. Aber wie man beobachten kann, bleiben die Nisthilfen erhalten und altern vor sich hin – und mit ihnen die Schädlinge.
Anmerkung: Es lohnt sich diese Internetseite mit den eindrucksvollen Bildern anzuschauen!
https://www.naturgartenfreude.de/wildbienen/parasiten/milben/